Ausgewählte Problemstellungen |
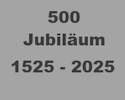 |
- Zur historischen Entwicklung
Das Jahr 2025 ist das Jahr eines historischen Jubiläums. 1525 begann der grosse Deutsche Bauernkrieg. Nach dem Politologen Friedrich Engels der »Angelpunkt der Deutschen Geschichte «. Sein Ausgang bestimmte den weiteren Verlauf in den deutschen Landen, abzulesen auch an den unterschiedlichsten Bewertungen der Ereignisse. Diese Bewertungen wiederum widerspiegelten selbst die vorherrschenden Blickrichtungen der Historiker in den folgenden Jahrhunderten. Direkt nach der Niederlage der Bauern verhinderten in der Geschichtsschreibung unterschiedliche religiöse Blicke die freie Sicht. Katholiken, Lutheraner und Calvinisten widersprachen sich heftigst und suchten auf der jeweiligen Gegenseite eine Schuld für die Gemetzel, selbstverständlich ohne den Fürsten eine solche anzulasten und eher den Bauern die Bluttaten zuschreibend.
Die spätere national orientierte Geschichtsschreibung konzentrierte sich vorrangig auf die Vorkommnisse in den herrschenden Schichten. Mehr oder weniger bewußt verlor sie die sozialen Bewegungen anderer Nationen dabei ganz aus den Augen. Erst spät stießen die Historiker auf den europäisch wirkenden Zusammenhang der Bauernrevolten in der frühen Neuzeit. Selbst die marxistische Historientheorie mit ihrer starken Orientierung auf ein zukunftsbestimmendes Industrieproletariat offenbarte zeitweise eine Verachtung der Bauern, stufte sie gar als reaktionär ein und mußte so, aus späterer staatstragender Anhängselei, bestimmte grenzübergreifende Zusammenhänge ignorieren. Das betrifft vor allem die unterschiedlichen Darstellungen in den beiden deutschen Staaten.
Erst in den 1970er bis 1980er Jahren konnten wieder europäisch orientierte Untersuchungen angestellt werden, die mit den Forschungen von → Wilhelm Zimmermann in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts begonnen hatten und mit Friedrich Engels Arbeiten eine neue Sicht auf den berechtigten Kampf der Bauern einleiteten.
- In der Historie zeigen einige Beispiele, das in den ländlichen Gebieten zuerst die lokal gesellschaftlich organisierte Arbeit funktionierte, bevor später der Eingriff von außen vorgenommen wurde. Erst mußte die freie Arbeit der Bauern und Siedler solide Mehrprodukte ergeben, die dann neue Begehrlichkeiten in den oberen Schichten weckten. Dann erst erfolgte der überbordende Abgabenzwang und damit der Widerstand der Produzierenden. Dieser Widerstand offenbarte sich in Europa deutlich sichtbar an den Küsten der Nordsee, im Harz und in Böhmen. (International vergleichbare Beispiele gab es z.B. in der Kolonialgeschichte Südamerikas und in Nordamerika in den Anfangsjahren der USA.)
- Während sich in Europa in den beiden vorangegangenen Jahrhunderten vor der sog. Frühbürgerlichen Revolution eine entsprechend langsame
Übergangsentwicklung von den Produktionen in den ländlichen markgenossenschaftlichen Gesellschaften hin zu allseitig
geführten Ware-Geld-Beziehungen vollzog, lokal in unterschiedlichen Tempi und nur in Ausnahmefällen beschleunigter (Hussitengeschichte in Böhmen,
Einhegungen in England), so offenbarte die anschließende Frühe Neuzeit eine qualitativ neue
Entwicklungsgeschwindigkeit beim Übergang zur Ware-Geld-Beziehung.
Als Treibmittel (für ein in allen Schichten wirksames Alltagsgeld) erwies sich die (historisch gesehen) schnelle massenwirksame Verbreitung von Geld-Münzen in allen Wirtschaftsbereichen, das mit den Edelmetalllieferungen aus den Plünderungen amerikanischer Vorkommen seine materielle Grundlage erhielt. Die stabile Organisation der europäischen Kirche in den zwei Jahrhunderten zuvor begünstigte die moralische Fehlorientierung und die organisationstechnischen Rahmenbedingungen für die Ware-Geld-Wirtschaft. Ein besonders deutliches Beispiel dafür bietet jedem Wirtschaftshistoriker die Ablaß-Organisation der katholischen Kirche.
Die sich im 16. und 17. Jahrhundert fast schlagartig in der gesamten Gesellschaft verbreitende Habgier, und zwar besonders als Habgier nach Geld-Münzen begann an der Spitze der Gesellschaftspyramide und setzte sich ausbreitend bis nach unten vollständig durch. Sie erreichte schließlich jedes entfernte Dorf, das lange davon unberührt blieb, weil zuvor der Austausch untereinander lebensfreundlicher funktionierte und nicht, wie nachträglich behauptet, auf ein schreckliches Minimalexistieren beschränkt blieb. Aber seit jedes abseitige Gebiet vom Münz-Geld erreicht werden konnte, wurde es auch dort möglich, Geldabgaben zu erheben. Große Steuerforderungen wurden schließlich durch zusätzliche Abgaben selbst in Kleinstbeträgen mit den Kleinstformen des gewöhnlich gewordenen Altagsgeldes manigfaltig ergänzt.
- An den Positionen zu den Bauernforderungen im großen Deutschen Bauernkrieg kann man erkennen,
welche Vorstellungen der jeweilige Historiker über die Herausforderungen der Lebensmittelproduktion in der Landwirtschaft hatte.
Selbst in der Gegenwart offenbart sich zuweilen eine mehr oder weniger versteckte Verachtung des Bauernstandes.
Diese Verachtung des Bauern ist tatsächlich eine Erbsünde aus der Frühen Neuzeit und der damaligen
→ Preisrevolution. Künstlerische
Darstellungen aus den Jahrhunderten zuvor beweisen, das Arbeit in der Landwirtschaft einen hohen Stellenwert besaß.
Der absolut größte Teil der Bevölkerung lebte auf dem Land und kannte den Aufwand, der geleistet werden musste.
Die neue Verachtung des Bauernstandes führte in logischer Konsequenz
zur Verachtung jeglicher produktiver Arbeit. (Ihr begegnet man noch heute, beispielsweise in unkritischer einseitiger Anwendung
automatisierter Kostenrechnungsverfahren.)
Diese Entwicklung vollzog sich europaweit. Aus den in www.bauernkriege.de aufgeführten Tabellen wird ersichtlich, das in ganz Europa größere und kleinere Bauernrevolten in gleicher historischer Zeitspanne aufflammten. (Interessant sind die zeitgleichen Aufstände im Orient mit vermutlich gleichen Ursachen erklärbar.)
- Zur Gegenwart und aktuellen Ereignissen
Die Protestaktionen der Bauern in der Gegenwart bleiben spannend. Sie widerspiegeln in erster Linie den zunehmenden Gegensatz zwischen Stadt und Land. Das Verhältnis der jeweiligen Bevölkerungsanteile hat sich in den letzten zwei Jahrhunderten völlig umgekehrt. Jetzt leben mehr Menschen in der Stadt als auf dem Land. Eine relativ kleine Anzahl Produzenten versorgt die Vielzahl der Städter. Die Stadtbevölkerungszahlen steigen schneller und schneller. Die wachsende Produktivität in der Landwirtschaft konnte bisher noch genügend Lebensmittel bereit stellen. Auffällig ist, das die Auffassungen über landwirtschaftliche Produktion von Städtern bestimmt wird. Jetzt steht Naturschutz an erster Stelle. Wurde auf dieser Web-Seite noch im Jahr 2006 die Vision einer Luftsteuer belacht, ist sie heute in Form der CO2-Abgabe bereits Gesetz. Entsprechend modernisieren sich Bauernforderungen. (Beispiel: »Keine CO2-Abgabe auf Treibstoffe für die Landwirtschaft«). Wer sich diese Forderung durchdenkt, wird den Bauern recht geben müssen. Jegliche Grenzwertsteuerungen mit unbedachten Zahlenvorgaben erweisen sich bei näherem Betrachten als Produktionshemmer. Die Verteuerung von Energie (jeder Energieart) verkennt, das Energie Grundlage der Steigerung von Arbeitsleistung ist. Energie wird in jedem Arbeitsprozeß benötigt. Die menschliche Arbeitskraft ist durch biologische Natur begrenzt.
Wenn durch Sateliten die Landwirtschaft überwacht wird, können die örtlichen Probleme sicher als sehr klein wargenommen werden, von dort ist der arbeitende Mensch nahezu unsichtbar. Es fehlt der Blick des Landmannes, der seinen Boden seit Jahrzehnten kennt. Zuweilen speicherten sich seine lokalen Erfahrungen über Generationen hinweg. Mit jedem Höfesterben gehen sie verloren.
In der Moderne werden soziale Kämpfe als Folgen von Wetterveränderungen interpretiert. Nachweise, das undurchsichtige Regierungsentscheidungen unvorhergesehene Verhältnisse schaffen können, werden unterschlagen. Über Gesetze, die die Natur schützen sollen, werden Zugangsmöglichkeiten für internationale Interessengruppen geschaffen. Die örtlichen Bauern können bei horrend steigenden Bodenpreisen nicht mithalten. Nach und nach gehen die Flächen in undefinierbaren Besitz über. Ein weiteres Beispiel zeigen die in Weite und Höhe immer ausgedehnteren Windkraftanlagen. Die Auswirkungen auf die sehr fragilen Strömungsverhältnisse im Luft-Ozean bleiben unerwähnt. Eine Reihe von Riesenwindrädern wirkt energetisch gesehen wie ein neues Gebirge. Auch in diesem Zusammenhang sind in Europa die Bodenverteilungskämpfe in eine neue Phase getreten.
Mit der Entwicklung der Produktivkräfte entwickeln sich auch die sozialen und politischen Forderungen der Bauern. Die Landwirte stellen ein zunehmendes Aufklaffen einer Schere zwischen den Preisen der Industrieprodukte und denen der Lebensmittel fest. Gleichzeitig erfordert die hochmoderne Technik in der Landwirtschaft extrem höhere Investitionsmittel und bedingt (ein in Ausbildung teures !) qualifiziertes hohes Fachwissen. Zusätzlich stellen die aus Industrieautomatisierung und gegenwärtiger Deindustriealisierung massenhaft freiwerdenden Arbeitskräfte ein neues soziales Problem dar, weil sie nicht im modernen landwirtschaftlichen Produktionsprozeß aufgefangen werden können.
Moderne Forderungen europäischer Landwirte
Hier sind erstmalig die modernen Forderungen europäischer Landwirte grob(!) zusammengestellt. Sie wurden aus den zusammengetragenen Tabellen (unabhängig von örtlicher und zeitlicher Zuordnung - ab 1999) abgelesen:
□ Europäische Parlamente und Regierungen sollen den »Green Deal« ablehnen.
□ Regierungen sollen Patente auf Leben verbieten.
□ Herkömmliche Zuchtmethoden dürfen nicht patentiert werden.
□ Gegen jahrzehntelange exportorientierte Agrarausrichtung.
□ Selbstversorgung des Landes erhöhen.
□ Keine ungerechtfertigten Schuldzuweisungen in Umweltfragen.
□ Gegen schlechtes Image der Landwirtschaft in der Öffentlichkeit.
□ Klimaschutzleistungen der Land-und Forstwirtschaft honorieren.
□ Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Maschinen.
□ Bessere Austauschbarkeit der Baueinheiten in Landwirtschaftlichen Maschinen.
□ Größere Bereitstellung von Reparaturpotential während der Erntezeit.
□ Gegen steigende Auflagenflut und Abschaffung der überzogenen Bürokratie.
□ Einrichtung einer Zukunftskommission für mehr Planungssicherheit in der Landwirtschaft.
Zur neuen Auseinandersetzung um Bodenbesitz□ Bessere Sicherung des Bodenbesitzes für Bauern im lokalen Einzugsbereich.
□ Bessere Sicherung vor Bodenübernahme durch internationale Konsortien.
□ Sicherung des Besitzes kleinerer Flächengrößen.
□ Keine Ermächtigungsgesetze, die den Bauern aus »Umweltschutzgründen« den Bodenbesitz absprechen.
□ Keine Steuerreform, die steigende und unsichere Erbschaftsverhältnisse schafft.
□ Verbot von Gen-Mais.
□ Besseres Überdenken willkürlicher Einschränkungen von Pflanzenschutzmitteln.
□ Gegen spontane Gesetzgebungen zum »Schutz der Insektenvielfalt«.
□ Den Schutzstatus von Natura 2000-Arten den vorhandenen Erhaltungszuständen anpassen.
□ Mehr wissenschaftliche Untersuchungen der Ökobilanz von Großstädten (z.B. Stickstoffbilanz).
□ Gesetze gegen Bauernbashing und für realere Darstellung des Arbeitsprozesses in der Landwirtschaft.
Zum Modernisierungsgrad und Energieeinsatz in der LandwirtschaftEs ist realistischer, von einem Anstieg des Energiebedarfs in der Landwirtschaft auszugehen. Energie wird in jedem landwirtschaftlichen Arbeitsprozeß benötigt. Die menschliche Arbeitskraft (Muskelkraft) ist biologisch durch die Natur begrenzt. Die physikalische Definition für Arbeit lautet Kraft X Weg. Auf Feldern und in Tierställen, in Gewächshäusern und Reinigungsanlagen wird Energie benötigt. Dementsprechend lauten die Forderungen:
□ Kein Blackout in der Landwirtschaft.
□ Keine Streichungen von Steuererleichterungen für Antriebsstoffe (z.B. für Agrardiesel usw.)
□ Gegen Auszahlungsverspätungen aus der »Gemeinsamen Agrarpolitik«, Prozesscharakter LW-Produktion beachten.
□ Die Wasserversorgung sichern. Bessere und unabhängige Ursachenforschung bei Verbrauch und Verschmutzung.
□ Die Bauern wollen Verordnungen, die das Wasser wirklich schützen und nicht nur Landwirte sanktionieren.
□ Beim Gewässerschutz stärker regional arbeiten und die Kooperation stärken.
Zur Tierhaltung□ Schutz der einheimischen Milchproduktion. Reale Milchpreise.
□ Gegen Pläne zur Senkung der Tierhaltung für undefinierbare bessere Ökobilanz der Landwirtschaft.
□ Zur Sicherung der Weidetierhaltung ein aktives Wolfsmanagement anpassen.
□ Gegen existenzbedrohende Massentötungen von Tieren.
□ Keine abrupte Schließung von Schlachtbetrieben, Viehaufzucht ist keine Fließbandfertigung.
□ Existenzerhaltung kleinerer Schlächtereien im lokalen Umfeld der Produktion.
□ Andere Preisgestaltung durch die Lebensmittel-Discounter.
- Die historische Darstellung sozialer Kämpfe offenbart immer einen Parteigeist des Schreibenden. Selbst ein Historiker, der von sich behauptet, völlig neutral die Verhältnisse darzulegen, zeigt eine Form der Parteinahme. Der immer größer werdende zeitliche Abstand gestattet jedoch eine sich ständig erweiternde objektivere Darstellungsform der Ereignisse und zwingt nicht mehr zur Anwendung profaner Propagandamethoden. Werden solche dennoch von einigen Historikern hin und wieder verwendet, sind sie sehr viel leichter zu durchschauen. Allerdings nehmen mit dem zeitlichen Abstand auch die gegensätzlich gerichteten Darstellungen zu. Eigentlich sind gerade die gegensätzlichen Wertungen das Spannende an der Historie. Die jüngsten Beispiele der Bauernproteste (Größte Traktorensternfahrt in der Geschichte der Bundesrepublik am 26.11.2019, harte Bauernproteste in den Niederlanden 2020, in Frankreich 2024 und in Polen 2025) offenbaren, das die Geschichte der Bauernkämpfe noch längst nicht an ihrem historischen Ende angekommen ist.
- Für die tabellarisch aufgeführten Bauernaufstände wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.
| globale Zeittafel | Literatur | Impressum |
Notizen Bauernkriege Problemstellungen &
Hans Holger Lorenz & (28.10.2013,27.07.2017,30.10.2024, 17.12.2024 & 27.01.2025